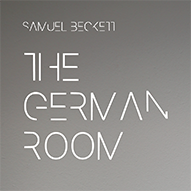English
Beckett in German
Writing in both English and French, Beckett has long been regarded as a quintessentially bilingual author, his self-translations challenging conventional hierarchies of original and translation. Yet documents from the Tophoven Archive in Straelen, presented here with generous permission from Erika Tophoven, illustrate his close involvement in the German translations of his work as well.
Beginning with Waiting for Godot in 1953, nearly all German translations were produced by Elmar and Erika Tophoven, in close collaboration with Beckett. During regular meetings in his Paris apartment, Beckett listened to draft translations, focusing especially on intertextual references, repetitions, and echoes— elements central to establishing leitmotifs not only within individual texts, but also across his oeuvre.
Elmar Tophoven worked from both English and French originals, using color-coded annotations to mark issues of grammar, vocabulary, and prosody. He collected problematic passages and variants, documenting the translation process in detail. This method of “transparent translation” served both as a tool for self-reflection and as a framework for exchange among translators.
Beckett’s German publisher Suhrkamp recognized the multilingualism of Beckett’s oeuvre, publishing bilingual and trilingual editions of his works. Suhrkamp also understood translation to be an iterative process; revisions made, for instance, in the context of stage productions were incorporated into later editions.
The objects on display document the translation process of That Time/Cette Fois/Damals (1976) and Company/Compagnie/Gesellschaft (1979), illustrating Elmar Tophoven’s working method as well as Beckett’s own involvement in the process.
Documents from the translation process of That Time/Cette fois/Damals, Tophoven Archive, Straelen
A solitary head appears suspended in darkness, listening to three disembodied voices recalling fragmented memories, each from a different life stage, imbued with a sense of isolation, regret and mortality. Written in English between 1974 and 1975, Beckett’s one-act play That Time premiered at London’s Royal Court Theatre in 1976. James Knowlson described it as a play “on the very edge of what was possible in the theatre” (602).
Elmar Tophoven began his first German drafts of That Time working with Beckett’s English typescript, collecting variants for problematic passages on index cards and marking questions he wanted to discuss with Beckett with “SB”. His annotated typescript breaks the text into smallest units, capturing its rhythmic, almost musical structure with precision. A first bilingual edition of That Time/Damals was published by Suhrkamp in 1981.
Documents from the translation process of Company/Compagnie/Gesellschaft, Tophoven Archive, Straelen
In Company, a solitary figure lies in darkness, accompanied only by a voice that evokes fragments of memory and thought. The text circles around the question of who is speaking – and to whom. Is the figure merely attempting to construct company for himself?
Although Beckett originally wrote Company in English, the French version (Compagnie) was published first, in January 1980. Elmar Tophoven drew on both for his German translation, pioneering the use of a computer to juxtapose the three languages. Particular attention was, as usual, paid to the title-word, with “company” rendered in the text as either “Gesellschaft” or “Geselligkeit”, depending on the context. Beckett himself suggested the subtitle, unique to the German edition: Gesellschaft. Eine Fabel.
Further reading/sources: Friedman et al. 1987; Fries-Dieckmann 2007; Garforth 1996; Sievers 2005; Elmar Tophoven 1975, 1984, 1988a, 1988b; Erika Tophoven 2011; van Hulle/Verhulst 2018.
Deutsch
Beckett auf Deutsch
Beckett, der sowohl auf Englisch als auch auf Französisch schrieb, gilt als Inbegriff des zweisprachigen Autors. Seine Selbstübersetzungen stellen herkömmliche Hierarchien zwischen Original und Übersetzung infrage. Dokumente aus dem Tophoven-Archiv in Straelen, die hier mit freundlicher Genehmigung von Erika Tophoven gezeigt werden, veranschaulichen jedoch auch seine enge Mitwirkung an den deutschen Übersetzungen seiner Werke.
Beginnend mit Warten auf Godot im Jahr 1953 entstanden fast alle deutschen Übersetzungen in enger Zusammenarbeit zwischen Elmar und Erika Tophoven mit Beckett selbst. Bei regelmäßigen Treffen in seiner Pariser Wohnung hörte sich Beckett die Übersetzungsentwürfe an und richtete seine Aufmerksamkeit insbesondere auf intertextuelle Bezüge, Wiederholungen und klangliche Echoeffekte. Diese Elemente waren zentral, um Leitmotive nicht nur innerhalb einzelner Texte, sondern auch über das Gesamtwerk hinweg zu erhalten.
Elmar Tophoven arbeitete sowohl mit den englischen als auch mit den französischen Originaltexten und markierte Probleme in Bezug auf Grammatik, Wortschatz und Prosodie mit farbigen Anmerkungen. Er sammelte problematische Stellen und Varianten und dokumentierte den Übersetzungsprozess detailliert. Diese Methode der „transparenten Übersetzung” diente sowohl als Instrument der Selbstreflexion als auch als Grundlage für den Austausch zwischen Übersetzern.
Becketts deutscher Verlag Suhrkamp würdigte die Mehrsprachigkeit von Becketts Werk und veröffentlichte zweisprachige und dreisprachige Ausgaben. Zudem verstand Suhrkamp Übersetzung auch als einen fortlaufenden Prozess: Überarbeitungen, die beispielsweise im Rahmen von Bühnenproduktionen entstanden, flossen in spätere Auflagen ein.
Die hier gezeigten Objekte dokumentieren den Übersetzungsprozess von That Time/Cette Fois/Damals (1976) und Company/Compagnie/Gesellschaft (1979) und veranschaulichen sowohl die Arbeitsweise von Elmar und Erika Tophoven als auch Becketts Mitwirkung.
Dokumente aus dem Übersetzungsprozess von That Time/Cette fois/Damals, Tophoven-Archiv, Straelen
Ein Kopf schwebt in der Dunkelheit und lauscht drei körperlosen Stimmen, die bruchstückhafte Erinnerungen aus verschiedenen Lebensphasen wiedergeben, bestimmt von Einsamkeit und einem Gefühl von Vergänglichkeit. Beckett schrieb That Time zwischen 1974 und 1975 auf Englisch; die Uraufführung fand 1976 am Royal Court Theatre in London statt. James Knowlson beschrieb es als ein Stück „am äußersten Rand dessen, was im Theater möglich war“ (S. 602).
Elmar Tophoven begann seine ersten deutschen Entwürfe ausgehend von Becketts englischem Typoskript. Er sammelte problematische Stellen auf Karteikarten und markierte Fragen zur Klärung mit Beckett mit „SB“. Sein annotiertes Typoskript zerlegt den Text in kleinste Einheiten und erfasst dessen rhythmische, fast musikalische Struktur mit großer Präzision. Eine erste zweisprachige Ausgabe von That Time/Damals erschien 1981 bei Suhrkamp.
Dokumente aus dem Übersetzungsprozess von Company/Compagnie/Gesellschaft, Tophoven-Archiv, Straelen
In Company liegt eine Figur auf dem Rücken im Dunkeln, begleitet nur von einer Stimme, die Fragmente von Erinnerung und Gedanken heraufbeschwört. Der Text kreist um die Frage, wer spricht – und zu wem. Versucht die Figur lediglich, sich selbst Gesellschaft zu erträumen?
Obwohl Beckett Company zunächst auf Englisch schrieb, erschien die französische Übersetzung (Compagnie) zuerst, im Januar 1980. Elmar Tophoven griff für seine deutsche Übersetzung auf beide Fassungen zurück und erprobte die Nutzung eines Computers, um die drei Sprachen nebeneinanderzustellen. Besonderes Augenmerk galt dem Titelwort, das im Deutschen je nach Kontext als „Gesellschaft“ oder „Geselligkeit“ wiedergegeben wird. Beckett selbst schlug den Untertitel vor, den nur die deutsche Ausgabe trägt: Gesellschaft. Eine Fabel.
Weiterführende Literatur/Quellen: Friedman et al. 1987; Fries-Dieckmann 2007; Garforth 1996; Sievers 2005; Elmar Tophoven 1975, 1984, 1988a, 1988b; Erika Tophoven 2011; van Hulle/Verhulst 2018.