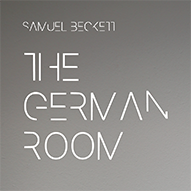English
Like his contemporaries James Joyce, T.S. Eliot and Ezra Pound, Beckett had a very broad knowledge of international literatures, particularly in the languages he was familiar with: English, French, Italian and German. Based on his early biographical contacts with Germany, Beckett gained a systematic overview of German and German-language literature in the years before his trip to Germany, particularly with the help of J. G. Robertson’s A History of German Literature (1902), which he methodically excerpted (Van Hulle/Nixon 2013, 82-83), and continued to expand this knowledge throughout his life. His works, diary and letters provide evidence of his having read, among others, Adorno, Barlach, Benn, Böll, Britting, Carossa, Claudius, Eich, Eichendorff, Enzensberger, Fried, Frisch, Fontane, Goethe, Brothers Grimm, Grimmelshausen, Gryphius, Hebbel, Heine, Hölderlin, Hofmannsthal, Kafka, Kant, Kleist, Klopstock, Leibniz, Lessing, Marcuse, Mauthner, Mörike, Rilke, Ringelnatz, Sachs, Schiller, Schopenhauer, Trakl, Uhland, Walther von der Vogelweide, Wurm and Weiss. Overviews of Beckett and German literature can be found in Fischer-Seidel/Fries-Dieckmann 2005; Nixon 2006; DLA Marbach 2017, among others. Information on German literature in Beckett's library can be found in Wilm/Nixon 2013, 19-31; Van Hulle/Nixon 2013, 82-102.
With regard to German music, the biographical evidence and textual references are not equally wide-ranging, but in addition to Beckett’s favourites Beethoven and Schubert (see below) there are references, for instance, to Mozart, Brahms, Wagner, Schönberg, Berg and Webern as well as to popular songs (such as the recursive song ‘Ein Mops kam in die Küche’, which appears in the second act of Waiting for Godot, or Marlene Dietrich's ‘Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt’ from the movie Der blaue Engel, 1930, in Dream of Fair to Middling Women (Beckett 1992, 11, 17)). In the case of German art, on the other hand, one can assume an almost encyclopaedic knowledge – the enormous range of works of art from painting, sculpture and architecture that Beckett saw during his trip to Germany alone can only be briefly touched on in the exhibition and will be comprehensively documented in the forthcoming edition of the ‘German Diaries’ by Mark Nixon and Oliver Lubrich.
Beyond the mere search for further intertexts and biographical evidence, the exhibition is primarily dedicated to the question of the functions that literature and, in particular, German-language literature, has in Beckett's work; in doing so, it also extends the focus to music, which is closely interwoven with language and literature in Beckett’s work. In the early phase, around his journey to Germany, Beckett uses allusions to German-language literature particularly frequently. In this phase, the allusions often have less systematic significance; they are often used in a satirical and playful form (e.g. the Faustian ‘die Erde hat mich wieder!’ becomes ‘die Merde hat mich wieder’ in Watt; SW I 376) or in Joycean mode, with light-hearted references to complex philosophical works (such as to Leibniz in Dream of Fair to Middling Women (Beckett 1992, 47)). But the literary allusions also have some individual systematic functions in the early work: Just like the biographical settings, including the journey to Germany, which Beckett incorporates into his fiction (from Hagenbeck's grave, First Love, SW IV 231, to the Lüneburger Heide, The Expelled, SW IV 250), the partly remote fruits of reading that Beckett incorporates into his prose already have the function of fictionalising the author, drawing him in among his creatures and dissolving the boundaries between memory and imagination – a motif that characterises Beckett’s entire later work (cf. e.g. ‘remembered, imagined, no matter’; Texts for Nothing 12, SW IV 335).
From the middle work onwards, the functions of literary allusions, references and sources in Beckett's work become clearer and more systematic, and he incorporates the occurrence of such elements into his aesthetic. Whereas Beckett had initially wanted to compete with the learned references of Joyce, Eliot or Pound, he now significantly reduced the number of explicit references and increasingly used their isolated occurrence as a design element: Based on the imagery of the formative work How It Is, one could say that the massive erudition is covered over by a mass of mud in which only individual elements sparkle forth. Theodor Adorno found the most apt image here, even if Beckett did not like his other interpretations of his work, namely that in Beckett's work the Western culture gained through comprehensive education only appears in remnants and rudiments and thus fluoresces (in the mud or in the ashes) („So beginnt sie zu fluoreszieren.“ Adorno 1961, 189).
Beckett himself described this aesthetic early on in his initially unpublished text Dream of Fair and Middling Women: “the little sparkle hid in ashes, the precious margaret and hid from many”, “the lift to the high spot is precisely from the tag and the ready-made. [...] You couldn’t experience a margarita in d’Annunzio because he denies you the pebbles and the flints that reveal it. The uniform, horizontal writing, flowing without accidence, of the man with a style, never gives you the margarita. But the writing of, say, Racine or Malherbe, perpendicular, diamanté, is pitted, is it not, and sprigged with sparkles; the flints and pebbles are there, no end of humble tags and commonplaces. They have no style, they write without style, do they not, they give you the phrase, the sparkle, the precious margaret. Perhaps only the French can do it. Perhaps only the French language can give you the thing you want.” (Beckett 1992, 47-48)
As a kind of poetics, this passage contains much of what would later characterise Beckett’s work: Firstly, he mentions writing without style and working with general phrases and commonplaces among which the special then sparkles forth – Beckett had already described this ideal of a ‘style without style’ early on in the ‘German Diaries’ (Knowlson 1996, 257) and later cited it as a reason for his switch from English to French (Gessner 1957, 32). In the passage he also refers to another image with a similar meaning, the sparkling, precious pearl (‘prætiosa margarita’), which he takes from another German author, Thomas a Kempis: “Denn schlecht und gering im Auge der meisten Menschen und fast ganz aus ihrem Andenken gerückt ist die wahre, himmlische Weisheit, die gering von sich denkt und auf Erden nicht groß heißen will; eine Weisheit, die viele mit ihrer Zunge rühmen, aber mit ihrem widersprechenden Wandel lästern, die aber desungeachtet die köstlichste Perle ist, verborgen vor den Augen der Vielen.” (De Imitatione Christi, Book III, Ch. 32; compare Ackerley/Gontarski 2006, 572-575)
In How It Is, Beckett takes up this image again (‘marguerites from the latin pearl’, SW II 465) and combines this stylistic ideal with his residual concept of memory and the existential situation of being trapped in the mud: “the humanities I had my God” (SW II 439) – the fictional creature (who is always close to the author) has lost much of its former erudition in its hopeless situation and only remembers fragments and remnants. Literature appears here as a fragment of a great cultural tradition, buried in the mud and only occasionally standing out, as a margarita of the shining past in the swamp of the present, as a hidden treasure in the environment of hollow phrases and dwindling words. (Later Beckett also uses this pattern in other forms – for example, in the few polysyllabic words in Stirrings Still, which is dominated by monosyllabic words).
Another function of literary references is characteristic of Beckett’s work – here, too, examples from German literature can be cited. Thus Beckett emphasises in various ways not only the fictionality of the author appearing in the text, but also the artificiality of the other fictional creatures. One way in which Beckett emphasises this aspect is that his creatures, in emotional situations, particularly like to refer to other figures from literary history (in a kind of community of artificial creatures in which seemingly personal memories turn out to be romantic fiction) – for example Krapp, who dreams of Fontane’s Effi Briest: "Effie. . . . [Pause.] Could have been happy with her, up there on the Baltic, and the pines, and the dunes." (Krapp's Last Tape, SW III 224)
In addition to Fontane, who is the subject of a separate exhibition module, another example from German literature is relevant to this manoeuvre: The play That Time contains in one of the remembered life perspectives (‘B’) a pair of lovers who sit silently next to each other without touching: “on the stone together in the sun on the stone at the edge of the little wood [...] vowing every now and then you loved each other just a murmur not touching or anything of that nature” (SW III 414), “all still just the leaves” (414). In his production notebook for the performance of That Time at the Schiller-Theater in Berlin (1976), Beckett wrote about this perspective: "Everything was silence now. We didn’t speak a word, we didn’t touch, we didn't look at each other ... Hölderlin Hyperion fragment" (quoted in Van Hulle/Nixon 2013, 93). This passage places Beckett’s pair of creatures in literary history via an intertext (creating an analogy to Hölderlin’s Hyperion and Melite) and thus emphasises their artificiality. As in Krapp's Last Tape, Beckett also subverts and ridicules romantic love (“not touching or anything of that nature”) – comparable to his satirical reference to Dante's lovers Paolo and Francesca in How It Is (“that day we prayed no further”; SW II 435; cf. Dante, Inferno V).
And finally, Beckett also adapts the choice of reference to the context – the Hyperion fragment is not only, like That Time (and Krapp's Last Tape), a kind of life review, but the reading scene referenced here (passages of Homer) is also, like That Time, a ghost show or a commemoration of the dead („Es war Gefühl der Vergangenheit, die Totenfeier von allem, was einst da war.“, Hyperion ed., 17). Behind the ‘romantic’ youth scene, the abyss of literary history opens up – the creatures are categorised as artificial constructs in literary history. (On Beckett and Hölderlin, see for instance Henrich 2016.)
Beyond the individual cases mentioned so far, however, the exhibition describes in particular points at which German-language writers and works take on architectural, long-term functions with lasting significance for Beckett's entire oeuvre. The following four exhibition modules are dedicated to these selected points.
Further reading/sources: Fischer-Seidel/Fries-Dieckmann 2005; Nixon 2006; DLA Marbach 2017.
Deutsch
Wie bei bei seinen Zeitgenossen James Joyce, T.S. Eliot und Ezra Pound kann man bei Beckett von einer sehr breiten Kenntnis internationaler Literaturen ausgehen, insbesondere in den ihm geläufigen Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Deutsch. Ausgehend von seinen frühen biographischen Kontakten nach Deutschland hat sich Beckett in den Jahren vor seiner Deutschlandreise ab 1934 insbesondere mithilfe von J. G. Robertsons A History of German Literature (1902), die er methodisch exzerpierte, einen sehr systematischen Überblick über die deutsche bzw. deutschsprachige Literatur verschafft (Van Hulle/Nixon 2013, 82-83) und diese Kenntnisse während seines gesamten Lebens weiter ausgebaut. Nachgewiesen ist seine Lektüre u.a. von Adorno, Barlach, Benn, Böll, Britting, Carossa, Claudius, Eich, Eichendorff, Enzensberger, Fried, Frisch, Fontane, Goethe, Brüder Grimm, Grimmelshausen, Gryphius, Hebbel, Heine, Hölderlin, Hofmannsthal, Kafka, Kant, Kleist, Klopstock, Leibniz, Lessing, Marcuse, Mauthner, Mörike, Rilke, Ringelnatz, Sachs, Schiller, Schopenhauer, Trakl, Uhland, Walther von der Vogelweide, Wurm und Weiss. Überblicksdarstellungen zu Beckett und der deutschen Literatur finden sich u.a. bei Fischer-Seidel/Fries-Dieckmann 2005; Nixon 2006; DLA Marbach 2017. Angaben zu deutscher Literatur in Becketts Bibliothek finden sich bei Wilm/Nixon 2013, 19-31; Van Hulle/Nixon 2013, 82-102. In Bezug auf deutsche Musik sind die biographischen Zeugnissen und Textbelege nicht gleichermaßen breit gestreut, neben Becketts Favoriten Beethoven und Schubert (s.u.) finden sich jedoch u.a. Hinweise auf Mozart, Schönberg, Berg und Webern sowie auf deutsches Liedgut (etwa das rekursive Lied „Ein Mops kam in die Küche“, das im zweiten Akt von Waiting for Godot vorkommt). Bei der deutschen Kunst kann man wiederum von geradezu enzyklopädischen Kenntnissen ausgehen – die enorme Spannbreite an Kunstwerken aus Malerei, Bildhauerei und Architektur, die Beckett allein bei seiner Deutschlandreise gesehen hat, kann in der Ausstellung nur kurz angerissen werden und wird in der im Erscheinen befindlichen Ausgabe der German Diaries von Mark Nixon und Oliver Lubrich umfassend dokumentiert.
Jenseits der bloßen Suche nach weiteren Intertexten und biographischen Zeugnissen widmet sich die Ausstellung insbesondere der Frage nach den Funktionen, die die Literatur und insbesondere die deutschsprachige Literatur in Becketts Werk haben; dabei weitet sie zum Abschluss den Fokus auch auf die Musik, die bei Beckett eng mit Sprache und Literatur verwoben ist. In der Frühphase, rund um seine Deutschlandreise, verwendet Beckett besonders häufig Anspielungen auf die deutschsprachige Literatur. In dieser Phase haben die Anspielungen oft weniger systematische Bedeutung, sie werden vielmehr oft in satirisch-spielerischer Form eingesetzt (so wird z.B. das faustische „die Erde hat mich wieder!“ in Becketts Watt zu “die Merde hat mich wieder”; SW I 376) oder in Joyceschem Gelehrtengestus, mit leichthändigem Verweis auf schwerwiegende philosophische Werke (etwa auf Leibniz, u.a. in Dream of Fair to Middling Women, vgl. Pilling 2003, 91, 294). Aber auch im Frühwerk haben die literarischen Anspielungen durchaus einzelne systematische Funktionen: Genauso wie die biographischen Schauplätze, etwa von der Deutschlandreise, die Beckett in seine Fiktion einbaut (von Hagenbecks Grab, First Love, SW IV 231, bis zur Lüneburger Heide, The Expelled, SW IV 250), haben die teils remoten Lesefrüchte, die Beckett in seiner Prosa verbaut, bereits hier die Funktion, den Autor zu fiktionalisieren, ihn mit unter seine Figuren zu ziehen und die Grenzen zwischen Erinnerung und Imagination aufzulösen – ein Motiv, das Becketts gesamte spätere Werkästhetik prägt (vgl. z.B. “remembered, imagined, no matter”; Texts for Nothing 12, SW IV 335).
Ab dem Mittelwerk werden die Funktionen von literarischen Anspielungen, Erwähnungen und Quellen in Becketts Werk dann deutlicher und systematischer, er baut das Vorkommen solcher Elemente in seine Werkästhetik ein. Hatte Beckett zunächst durchaus mit den enzyklopädischen gelehrten Verweisen eines Joyce, Eliot oder Pound konkurrieren wollen, verringert er nun deutlich die Zahl mindestens der expliziten Verweise und setzt deren vereinzeltes Vorkommen mehr und mehr als Gestaltungselement ein: Ausgehend von der Bildlichkeit des prägenden Werkes How It Is könnte man sagen, dass die massive Gelehrsamkeit von einer Menge Schlamm überdeckt wird, in dem nur noch einzelne Elemente hervorfunkeln. Theodor Adorno hat hier, auch wenn Beckett dessen sonstige Werkinterpretationen nicht gefielen, das treffendste Bild gefunden, nämlich dass in Becketts Werk die durch umfassende Bildung gewonnene westliche Kultur nur in Resten und Rudimenten auftaucht und so (im Schlamm oder in der Asche) fluoresziert („So beginnt sie zu fluoreszieren.“ Adorno 1961, 189). Beckett selbst hatte diese Ästhetik bereits früh beschrieben, in seinem zunächst unveröffentlichten Text Dream of Fair and Middling Women: “the little sparkle hid in ashes, the precious margaret”, “the lift to the high spot is precisely from the tag and the ready-made. [...] You couldn’t experience a margarita in d’Annunzio because he denies you the pebbles and the flints that reveal it. The uniform, horizontal writing, flowing without accidence, of the man with a style, never gives you the margarita. But the writing of, say, Racine or Malherbe, perpendicular, diamanté, is pitted, is it not, and sprigged with sparkles; the flints and pebbles are there, no end of humble tags and commonplaces. They have no style, they write without style, do they not, they give you the phrase, the sparkle, the precious margaret. Perhaps only the French can do it. Perhaps only the French language can give you the thing you want.” (Dream of Fair and Middling Women, Disjecta 47). Diese Passage enthält als eine Art Poetik vieles von dem, was Beckett später prägt: Zunächst erwähnt er hier das Schreiben ohne Stil und die Arbeit mit Phrasen und Gemeinplätzen, unter denen das Besondere dann hervorfunkelt – dieses Ideal eines stillosen Stils hatte Beckett schon früh in den German Diaries beschrieben (Knowlson 1996, 257) und gab es später als einen Grund für seinen Wechsel vom Englischen ins Französische an (Gessner 1957, 32). In der Passage verweist er zudem auf ein anderes Bild mit ähnlicher Bedeutung, die hervorfunkelnde, wertvolle Perle („prætiosa margarita“), die er aus einem weiteren deutschen Autor, Thomas a Kempis, entnimmt: “Denn schlecht und gering im Auge der meisten Menschen und fast ganz aus ihrem Andenken gerückt ist die wahre, himmlische Weisheit, die gering von sich denkt und auf Erden nicht groß heißen will; eine Weisheit, die viele mit ihrer Zunge rühmen, aber mit ihrem widersprechenden Wandel lästern, die aber desungeachtet die köstlichste Perle ist, verborgen vor den Augen der Vielen.” (De Imitatione Christi, Buch III, Kap. 32; vgl. hierzu Ackerley/Gontarski 2006, 572-575). In How It Is nimmt Beckett dieses Bild wieder auf („marguerites from the latin pearl“, SW II 465) und verbindet das Stilideal mit seiner residualen Erinnerungskonzeption und der existentiellen Situation des Gefangenseins im Schlamm: „the humanities I had my God“ (SW II 439) – die fiktive Kreatur, die immer nah am Autor ist, hat in ihrer ausweglosen Situation viel von der früheren Gelehrsamkeit verloren und erinnert sich nur noch an Bruchstücke und Reste. Die Literatur kommt hier als Fragment einer großen Kulturtradition, im Schlamm verschüttet und nur gelegentlich herausragend, als margarita der glänzenden Vergangenheit im Sumpf der Gegenwart, als versteckter Schatz in der Umgebung der hohlen Phrasen und schwindenden Wörter vor. (Später verwendet Beckett dieses Muster auch in anderer Form – so stechen etwa die wenigen mehrsilbigen Wörter im durchweg einsilbig gehaltenen Stirrings Still heraus.)
Eine weitere Funktion der literarischen Verweise ist prägend für Becketts Werk – auch hier lassen sich Belege aus der deutschen Literatur anführen. So betont Beckett in verschiedener Hinsicht nicht nur die Fiktionalität des im Text vorkommenden Autors, sondern auch die Artifizialität der anderen vorkommenden Figuren. Eine Form, in der Beckett diesen Aspekt heraushebt, ist, dass seine Kreaturen sich in emotionalen Situationen besonders gern auf andere Figuren der Literaturgeschichte beziehen (in einer Art Gemeinschaft der künstlichen Kreaturen, in der persönliche Erinnerungen sich als romantische Fiktion herausstellen) – so etwa Krapp, der von Fontanes Effi Briest träumt: „Effie. . . . [Pause.] Could have been happy with her, up there on the Baltic, and the pines, and the dunes.” (Krapp’s Last Tape, SW III 224) Neben Fontane, mit dem sich ein eigenes Modul der Ausstellung beschäftigt, ist für dieses Manöver ein weiteres Beispiel aus der deutschen Literatur einschlägig: Das Stück That Time enthält in einer der erinnerten Lebensperspektiven (“B”) ein Liebespaar, das schweigsam nebeneinander sitzt und sich nicht berührt: “on the stone together in the sun on the stone at the edge of the little wood […] vowing every now and then you loved each other just a murmur not touching or anything of that nature” (TT, SW III 414), “all still just the leaves” (414). In seinem Produktionsnotizbuch für die Aufführung von That Time am Berliner Schiller-Theater (1976) notierte Beckett zu dieser Perspektive: “Alles war nun Stille. Wir sprachen kein Wort, wir berührten uns nicht, wir sahen uns nicht an … Hölderlin Hyperion-Fragment” (zitiert in Van Hulle/Nixon 2013, 93). Diese Passage ordnet also Becketts Paar per Intertext in die Literaturgeschichte ein (hier analog Hölderlins Hyperion und Melite) und betont so ihre Artifizialität. Wie in Krapp’s Last Tape subvertiert Beckett hier zudem die romantische Liebe bzw. zieht sie ins Lächerliche („not touching or anything of that nature”) – vergleichbar seinem satirischen Verweis auf Dantes Liebespaar Paolo und Francesca in How It Is („that day we prayed no further”; SW II 435; vgl. Dante, Inferno V). Und schließlich passt Beckett die Auswahl des Verweises auch an den Kontext an – das Hyperion-Fragment ist nicht nur, wie That Time (und Krapp’s Last Tape), eine Art Lebensrückschau, sondern die hier referenzierte Leseszene (Homer-Passagen) ist auch, wie That Time, eine Geisterschau bzw. ein Totengedenken („Es war Gefühl der Vergangenheit, die Totenfeier von allem, was einst da war.“, Hyperion-Ausgabe, 17). Hinter der ‚romantischen‘ Jugendszene öffnet sich also der Abgrund der Literaturgeschichte – die Figuren werden als artifizielle Konstrukte in die Literaturgeschichte eingeordnet. (Zu Beckett und Hölderlin s. z.B. Henrich 2016.)
Jenseits der bisher genannten einzelnen Fälle beschreibt die Ausstellung jedoch insbesondere Punkte, an denen deutschsprachige Schriftsteller und Werke architektonische, tragende, langfristige Funktionen einnehmen und so nachhaltige Bedeutung für das gesamte Schaffen und Werk Becketts haben. Diesen ausgewählten Punkten widmen sich die folgenden vier Ausstellungsmodule.
Weiterführende Literatur/Quellen: Fischer-Seidel/Fries-Dieckmann 2005; Nixon 2006; DLA Marbach 2017.